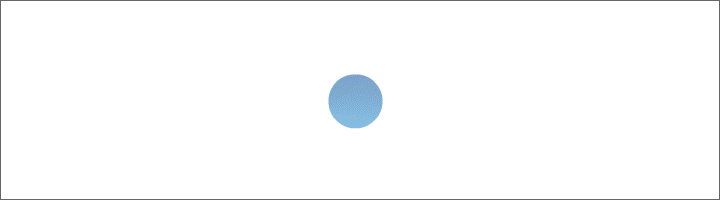AUGEN AUF!!!!!
Zum *Fracking* - wie alles kaputt gemacht wird... Dabei kann so leicht Energie gewonnen werden mit z.B. Biomasse-Pyrolyse - aber
DAS darf ja nicht sein - zu kostengünstig und die Menschheit kann dann nicht mehr unter Druck gesetzt werden! Armselig alles...
Und warum wird der 4+2-Vertrag von 1991 nicht endlich ausgeführt? Solange DAS nicht geschieht, ist Deutschland staatenlos und
weiterhin eine Deutschland GmbH... Deswegen auch PERSONALausweis....
Und noch mehr Aufklärung, was alles kommt... Die Spitze des Eisberges!
http://netzfrauen.org/2015/04/17/gasland-fracking-claims-der-konzerne-in-nrw-erdbeben-in-leipzig/
Bericht am 11. März 2013 in *Die Welt*

Hier ist alles gut beschrieben über das Fracking....
http://de.wikipedia.org/wiki/Hydraulic_Fracturing
Sollte die Seite irgendwann entfernt werden - hier der gesamte Text. Denn ALLES, was den *Obersten* nicht passt,
wird ja heutzutage gerne entfernt.
Hydraulic Fracturing
Hydraulic Fracturing (von englisch to fracture ‚aufbrechen‘, ‚aufreißen‘; auch Fracking,[1] „Hydrofracking“, „Fraccing“,[2] Frac’ing[3] oder Frac Jobs genannt[4],
deutsch auch hydraulische Frakturierung[5],hydraulisches Aufbrechen[6], hydraulische Risserzeugung[7]) oder hydraulische Stimulation [8] ist eine Methode
vor allem der Erdöl- und Erdgasförderung, bei der in technische Tiefbohrungen eine Flüssigkeit („Fracfluid“) eingepresst wird, um im Reservoirgestein Risse
zu erzeugen, aufzuweiten und zu stabilisieren.
Dadurch wird die Gas- und Flüssigkeitsdurchlässigkeit der Gesteinsschicht erhöht, so dass Fluide wie Erdgas, Erdöl oder Wasser nun leichter zur Bohrung
hin fließen können. Dadurch wird bei der Erdöl- und Erdgasförderung die Wirtschaftlichkeit erhöht. Durch Fracking wird der Wirkungsgrad von
Geothermiebohrungen erhöht, weil das warme Gestein besser vom Wasser durchströmt wird und das Wasser mehr Wärme aufnimmt.[8]
Inhaltsverzeichnis
· 4 Geschichtliche Entwicklung
o 5.1 Aspekt der Klimaschädlichkeit
o 5.2 Eingesetzte Chemikalien, Grundwassergefährdung
o 5.3 Entzündliches Erdgas im Trinkwasser
· 6 Clean-Fracking in Österreich
o 7.1 Geschichte des Hydraulic Fracturing in Deutschland
o 7.2 Debatte über Fracturing in Deutschland
Anwendungsgebiete
Mittels Hydraulic Fracturing wird eine im Gestein nicht gegebene Durchlässigkeit für die Öl- oder Gasförderung hergestellt.
Zuschlagstoffe wie Sand sorgen dafür, dass sich diese Risse dann nicht wieder schließen können. Nach dem Abpumpen
des Fracfluids kann Erdgas oder Erdöl aus dem sonst dichten Gestein gefördert werden, so dass eine Förderung sonst
unerreichbarer Vorkommen möglich wird. In bestehenden herkömmlichen Öl- und Gasfeldern wird es eingesetzt, um
Restmengen von flüssigen und gasförmigen fossilen Energievorkommen zugänglich zu machen, deren Fördervolumen
durch eine geringe Permeabilität des Reservoirgesteins abnehmend ist.
Das „Fracken“ basiert zumeist auf mehreren Horizontalbohrungen innerhalb der Lagerstätten. 2008 wurde diese Technik vor
allem in den USA mehr als 50.000 mal angewendet.[9] Die einzelnen Bohrlöcher werden jeweils einzeln gefrackt und dabei
seismisch überwacht, um die Rissausbreitung über das Druckniveau steuern zu können. Die Technik selbst ist bereits relativ
alt. Ihre Entwicklung im Bereich der Erdöl- und Erdgasproduktion geht bis in die 1940er Jahre zurück. Erstmals wurde sie 1949
kommerziell angewendet.[10] In anderen Bergbaubereichen ist die Anwendung noch älter.[11] Erst mit der deutlichen Zunahme
der Öl- und Gaspreise wird das Verfahren zunehmend und vor allem in den USA angewendet. Dort werden etwa 90 % der
Gasbohrungen gefrackt, wobei gerade der Gaspreis durch ein so entstandenes temporäres Überangebot zusammengebrochen
ist und viele Firmen Sonderabschreibungen vollziehen.
Anwendungen der Reservoirstimulation mittels Fracken sind außerhalb der Produktion von Erdöl und Erdgas ebenfalls geläufig:
· Stimulation des Wasserflusses in der Tiefen-Geothermie,
· Stimulation von Grundwasserbrunnen,[12]
· im Bergbau auf feste mineralische Ressourcen. So bietet es sich in einigen Fällen an, Bohrungen zur langfristigen
Vorentgasung in Steinkohlegruben zu fracken.
Technik
Beim Hydraulic Fracturing wird eine Stützmittelflüssigkeit in eine meist mehrere hundert Meter tiefe Bohrung gepresst.
Der hierbei im zu frackenden Bereich erreichte Druck muss dabei die geringste im Gestein anliegende Spannung überschreiten.
Wenn dies der Fall ist, drückt die Flüssigkeit das Gestein auseinander. Im Normalfall liegen die niedrigeren Spannungsrichtungen
in der Horizontalen, da der senkrechte lithostatische Druck (aus der Schwerkraft der auflagernden Gesteinsschichten) ohne weitere
Einflüsse die Hauptspannung darstellt. So orientieren sich durch Fracking entstehende Sprünge vorwiegend in etwa senkrecht
stehenden Flächen – und folgende in wiederum auch zu diesen senkrecht stehenden Flächen. Im Fall vontektonischer Fernwirkung
kann die Hauptspannungsrichtung jedoch deutlich von der Senkrechten abweichen.
Nach dem „Sprengen“ dieser Risse wird die eingepresste Flüssigkeit, die unter dem Druck der Gesteinsschicht steht, so weit wie möglich
zurückgepumpt. Der beigesetzte Sand hat die Aufgabe, in den Rissen zu verbleiben und diese gegen den anstehenden Gesteinsdruck porös
für den Fluss von Erdgas und Erdöl offen zu halten. Auch Additive des Fracfluids verbleiben durch Adhäsionswirkung an den
Flüssig-fest-Phasengrenzen eher im Gestein.
Um das gelöste Gas zu fördern, müssen um die ursprüngliche Bohrung herum weitere Bohrungen niedergebracht werden.
The Guardian geht von sechs bis acht Bohrungen pro Quadratmeile aus.[13]
Fracfluide
Beim Fracfluid handelt es sich meist um Wasser, dem weitere Stoffe beigemischt werden. So wird vor allem Sand beigestellt, der die Aufgabe
hat, die erzeugten Risse offen zu halten. Dazu werden weitere Additive zugegeben. Beispiele für mögliche Additive und den Zweck ihres Einsatzes sind:[14]
· Gele (z. B. aus Guar oder MC) – Erhöhung der Viskosität des Fracfluids zum besseren Sandtransport,
· Schäume (aus Schaumbildner und z. B. CO2 oder N2) – Transport und Ablagerung des Sandes,
· Säuren (Salzsäure, Essigsäure, Ameisensäure, Borsäure) – Auflösung von Mineralen,
· Korrosionsschutzmittel – Schutz der Anlagen bei Zugabe von Säuren,
· Brecher (Säuren, Oxidationsmittel, Enzyme) – Verringerung der Viskosität des Fracfluids zur besseren Rückholung der Fluide,
· Biozide – Verhinderung von Bakterienwachstum an organischen Bestandteilen,
· Fluid-Loss-Additive (Sand, Lehm, …) – Verringerung des Ausflusses des Fracfluids in das umliegende Gestein,
· Reibungsminderer (Latexpolymere, Acrylamid-Copolymere) – Verringerung der Reibung innerhalb der Fluide.
Clean Fracking (s. u.) bezeichnet demgegenüber eine neue Methode des Frackings, in dem nur Wasser, Bauxit-Sand und Stärke
verwendet werden sollen.
Wirtschaftlichkeit
Die Wirkung des Hydraulic Fracturing ist unmittelbar auf die Umgebung des horizontalen Bohrlochs im Gestein begrenzt.
Je weiter die Risse aufreißen, desto stärker sinkt der Druck ab, bzw. desto mehr Wasser muss nachgepresst werden.
Das begrenzt die Risslänge, ebenso wie die Schichtdicke des Speichergesteins. Weil die auf diese Weise künstlich
erzeugten Risse jeweils nur eine relativ eng um das Bohrloch begrenzte Wirkung haben, ist die Zahl der nötigen Bohrungen
im Vergleich zur herkömmlichen Erdgasförderung höher. Herkömmliche Gasfelder liegen in durchlässigen Gesteinen, die
das Gas weiträumig um ein Bohrloch herum und über lange Zeit förderbar halten. Das ist beim Fracken nicht so, und der
Aufwand für die so wesentlich höhere Zahl von horizontalen Bohrungen erhöht den Aufwand und die Kosten für diese Fördertechnik.
Die Förderung unkonventioneller Gasvorkommen ist daher wesentlich aufwändiger als die bisherige Gasförderung.
Darüber hinaus sind die Förderraten, also die Menge der täglichen Förderung im Zeitverlauf, in solchen gefrackten Bohrungen
wesentlich stärker zurückgehend als in herkömmlichen Lagerstätten. Die Menge von Gas oder Öl, die über ein Bohrloch erreichbar ist,
ist bei dieser Technik zwangsläufig wesentlich kleiner. Eine volle Förderung ist also nur sehr kurz möglich, Rückgangsraten über
70 % pro Jahr sind nicht ungewöhnlich[15]. Die Zahl der Bohrungen muss also deutlich höher liegen als bei der konventionellen Förderung.
Der Ertrag mittels Hydraulic Fracturing kann auch energetisch gesehen – also in der Bilanz der zur Bohrung und zur Förderung nötigen
Gesamtenergie und der daraus zu gewinnenden Energiemenge in Form von Erdgas – nicht mit konventioneller Förderung von Erdgas mithalten.
Während in Deutschland und Frankreich deutliche Vorbehalte gegen das Fracking existieren und Frankreich bereits grundsätzlich darauf
verzichtet, plant innerhalb der EU vor allem Polen, die Förderung unkonventionellen Gases in den nächsten Jahren zu intensivieren.[16]
In den USA sind aufgrund von Fracking die Energiepreise zurückgegangen.[17].
Geschichtliche Entwicklung
Die Wirtschaftlichkeit von Fracking ist erst seit wenigen Jahren durch neue Technologien gegeben. So wurde allein in der Bakken-Formation
in den US–Bundesstaaten North Dakota und Montana die Tagesproduktion von 2006 bis 2012 von Null auf rund 500.000 Barrel Öl gesteigert.
Das entspricht etwa einem Drittel der Förderquote Libyens. Damit fördert North Dakota bereits mehr Öl als Alaska, mit steigender Tendenz.[18]
Vorangetrieben werden die neuen Fracking–Technologien, zusammengefasst unter dem Namen Superfracking, vor allem durch die Branchenführer
Baker Hughes, Schlumberger und Halliburton. Schlüssel für den Erfolg waren dabei neue Technologien wie RapidFrac zum horizontalen Bohren
in der Tiefe, HIWAY, eine Gesteinskörnung, die verhindert, dass sich die Risse wieder verschließen, und DirectConnect, eine Technik zur
kontrollierten Erweiterung von Rissen mit Explosionen bzw. dem schnellen Schmelzen des Gesteins durch eine Strahltechnik anstelle herkömmlicher
Bohrköpfe.[19]
Die optimale Mischung aus Wasser, Sand, Stützmittel und anderen chemischen Schmierstoffen zu kalibrieren, dauerte mehrere Jahrzehnte
bis 1998, als Nick Steinsberger und andere Ingenieure bei Mitchell Energy eine Technik namens slickwater fracking entwickelten.[20]
Umweltprobleme

Schematische Darstellung einer Bohrung mit potentiellen Risiken für die Umwelt
Mögliche Umweltschäden sind wie bei allen Bohrtechniken denkbar. Das erste Problem ist der Umgang mit dem Bohrlochwasser,
das nach dem Fracken wieder abgepumpt und dann an der Erdoberfläche entsorgt werden muss oder aber in einer weiteren Bohrung
wieder in eine andere Gesteinsschicht zurückgepresst wird. Dieses Bohrlochwasser ist, da es aus dem Fördergestein herausgepumpt wird,
dadurch meist schon deutlich stärker mit umweltschädlichen Stoffen versetzt als zuvor. Das Bohrloch wird in Schichten angelegt, die
Kohlenwasserstoffe wie Gas und Öl enthalten, und diese finden sich dann zwangsläufig auch schon in dem wieder heraufgepumpten Wasser.
Der Umgang mit den beträchtlichen Mengen von zudem teilweise stark mit metallischen Salzen belastetem Bohrlochwasser ist demnach
außerordentlich kritisch zu betrachten, zumal eine einfache Reinigung in normalen Klärwerken hier nicht in Betracht kommt.
Dazu ist bei nicht sachgerechtem Vorgehen auch ein Übertritt der zugesetzten Fracfluide in tiefe Grundwasserschichten prinzipiell nicht völlig
auszuschließen, ein direkter Übertritt von Erdgas in direkt an der Erdoberfläche anstehende Grundwasserschichten dagegen nur bei sehr
mangelhafter Bohrlochabdichtung denkbar. Da die Fördergesteine meist relativ tief liegen, ist eine solche Gefährdung also erst nach längeren
Zeiträumen wahrscheinlich. Es wird diskutiert, ob eine verlässliche Bohrlochabdichtung gegenüber den grundwasserführenden Schichten
überhaupt gewährleistet werden kann.[21] Momentan werden die Bohrungen im Bereich der Grundwasserleiter mit eingepresstem
Zement „fixiert“, wobei noch ungeklärt ist, ob sich diese Abdichtungen als dauerhaft erweisen. Bei späterer Undichtigkeit des Zementmantels
könnten extrem salzhaltiges Wasser oder auch gesundheitsschädliche Frac-Hilfsstoffe in das Grundwasser übertreten. Noch vor wenigen
Jahren wurde ein solcher Übergang zum Beispiel im Falle vonKohleflözgasen von der amerikanischen Umweltbehörde (EPA) als unwahrscheinlich
angesehen, wobei u. a. mit den großen Entfernungen zwischen den Reservoiren und den grundwasserführenden Aquiferen und eben der geringen
Permeabilität der gefrackten Schichten selbst argumentiert wurde.[14] Dementsprechend stuften auch die meisten Unternehmen, die diese Methode
einsetzen, diese Gefahr als nicht sehr hoch ein. Eine Garantie, dass sich die erzeugten Gesteinsrisse nicht auch in wasserführenden Schichten
fortsetzen, könne allerdings nicht gegeben werden, was freilich auch für die meisten anderen geologischen Fragestellungen gilt, da eine vollständige
Erkundung der Verhältnisse unter Tage nie möglich ist. Ebenfalls nicht grundsätzlich ausschließbar sei das Eindringen des Erdgases in
Grundwasserschichten oder gar ein Austreten an der Erdoberfläche, weshalb es nach wie vor Umweltschutzbedenken gibt.[22]
Weitere direkte Umweltbelastungen entstehen z. B. durch die beträchtliche Zahl von LKW, die für die nötigen Mengen von Frischwasser sorgen,
und durch die nicht geräuschlose Bohrtätigkeit selbst.
Aspekt der Klimaschädlichkeit
Die Auswirkungen der Schiefergasförderung auf das Klima stehen momentan im Zentrum einer kontrovers geführten wissenschaftlichen
Diskussion. Robert Howarth von der Cornell University kommt 2011 in einer Studie[23] zu dem Schluss, dass bei der Stromerzeugung mit
Erdgas aus der Marcellus-Formation Treibhausgase emittieren, deren Menge vergleichbar mit der aus Kohlekraftwerken emittierten Menge ist.
Verantwortlich dafür ist Methan, das bei der Zwischenlagerung des Fracking-Wassers in offenen Tanks sowie durch Pipeline-Lecks freigegeben
wird. Methan ist als Treibhausgas etwa 20-mal so wirksam wie Kohlendioxid.
Eine Studie der Carnegie Mellon University kommt zu anderen Ergebnissen.[24][25] Demnach sind die Treibhausgasemissionen bei der
Stromerzeugung mit aus der Marcellus-Formation gefördertem Gas 3 % höher als bei konventionellem Erdgas und 3 % niedriger als bei
importiertem Flüssiggas. Strom aus Schiefergas sei etwa 20 bis 50 % weniger klimaschädlich als Strom aus Kohlekraftwerken.
Das Umweltbundesamt schreibt in seiner „Einschätzung der Schiefergasförderung in Deutschland“ im Dezember 2011 dazu: „Die bislang
publizierten Zahlen bewegen sich auf dem Erkenntnisniveau von Schätzungen oder theoretischen Überlegungen. Messdaten fehlen, so dass
die Autoren meist selbst zur Vorsicht beim Umgang mit von ihnen genannten Zahlen mahnen.“[26]
Eingesetzte Chemikalien, Grundwassergefährdung
Beim Hydraulic Fracturing werden in die Bohrung große Mengen Wasser und Quarzsand (Größenordnung 10 Mio. Liter pro Bohrung) sowie
3 bis 12 verschiedene Chemikalien (u. a. Biozide, in Summe 0,5 bis 2 % Volumenanteil) eingepresst.[27] Eine Untersuchung des US-Kongresses
vom April 2011 summiert die zwischen 2005 und 2009 eingesetzten Mengen an Frac-Hilfsstoffen auf über 43 Millionen Liter. Über die Auswirkungen
der Additive auf die Umwelt sind seit einiger Zeit in der Öffentlichkeit Diskussionen entbrannt, da einige der eingesetzten Additive toxisch bzw. laut
der deutschen Gefahrstoffverordnung karzinogen, giftig oder anderweitig gesundheitsschädigend sind.[28] Der Anteil der Additive in der Flüssigkeit
ist prozentual gemessen gering, jedoch bemisst sich die absolute Menge durchaus in Tonnen, da insgesamt sehr große Mengen der Frac-Flüssigkeit
benötigt werden.[29][30] Die Gesamtmenge der eingebrachten Chemikalien multipliziert sich dabei mit den erheblichen Wassermengen, die bis
zu 6000 t Wasser pro Bohrung ausmachen können.
Die Additive werden normalerweise von den Bohrfirmen geheim gehalten. Bekannt sind beispielsweise Butyldiglycol (typisch 0,2 l/t Wasser (0,2 l/1000 l)),
um die Tragkraft der Flüssigkeit für Sand zu erhöhen, Cholinchlorid (0,7 l/1000 l), um den Porenraum im Schiefer zu erhalten, und
Polyethylenglycol-monohexylether (0,07 l/1000 l). Laut Spiegel Online werden auch leichtes Paraffinöl, Octylphenolethoxylat, Magnesiumchlorid,
Magnesiumnitrat, Tetramethylammoniumchlorid und ein Biozidverwendet. Mit einigen dieser Stoffe dürfe der Mensch nicht ungeschützt in Kontakt
kommen, auf gar keinen Fall dürften sie ins Trinkwasser gelangen.[30]
Eine Untersuchung im Auftrag des US-Kongresses vom April 2011 summierte die 2005 bis 2009 eingesetzten Mengen an Frac-Hilfsstoffen, die
karzinogene aromatische Verbindungen wie beispielsweise Benzol enthalten, auf über 43 Millionen Liter. Eine unmittelbare Umweltbelastung
ergibt sich dabei vor allem durch unzureichend von den verschiedenen Additiven gereinigte Abwässer, die in den USA in Oberflächengewässer
eingeleitet werden.[31] Firmen, die diese Methode einsetzen, verweisen zwar auf die geringen Anteile dieser Zusatzstoffe, jedoch ist bei einigen
der bedenklichen Stoffe nicht die Verdünnung entscheidend – sie dürften nach den in Deutschland geltenden Wassergefährdungsklassen
grundsätzlich überhaupt nicht mitVorfluter-Wasser vermischt werden. Als weiteres Problem wird angesehen, dass sich Teile der Fracfluide in
den Rissen ablagern. Dies ist im Fall einiger Zusätze (Sande) sogar gewollt, da sie die Risse offenhalten. Ein Großteil des restlichen Fracfluides
wird allerdings bei der Druckabsenkung am Ende des Vorgangs wieder zur Bohrung zurückgeführt. Des Weiteren besteht bei der späteren Produktion
ein Stoffstrom zur Bohrung hin und nicht weg von ihr. Insgesamt wird etwa die Hälfte der eingesetzten Flüssigkeit wieder an die Oberfläche gepumpt.
Die beteiligten Unternehmen sprechen hierbei von produced water. Dieses kontaminierte Wasser wird außerdem vor seinem Abtransport in offenen
Tanks oder Gruben zwischengelagert, wobei durch Versickerung und Verdunstung Frac-Hilfsstoffe in die Umwelt gelangen. Von der
Environmental Protection Agency (EPA, US-amerikanische Umweltschutzbehörde) wurde die Gefahr eines Übergangs ins Trinkwasser zunächst
als eher untergeordnet eingestuft. Im November 2010 beauftragte der US-Kongress die EPA mit einer Neubewertung der potentiellen Kontamination
von Grund- und Trinkwasser durch den Frac-Prozess. Die Ergebnisse dieser Studie wurden im Dezember 2012 veröffentlicht.[32]
Im ARD-Magazin Monitor vom 18. November 2010 stufte die Leiterin der Wasserbehörde Hagen mehrere der bei (Probe-)Bohrungen in Deutschland
verwendeten Stoffe als wassergefährdend ein. Kommunalpolitiker beklagten, nicht über die Bohrungen informiert worden zu sein. Auch wurde das
deutsche Bergrecht kritisiert. Es ermöglicht, dass die Bergämter ohne Beteiligung etwa der Umweltministerien eine Technik wie Fracking genehmigen
können.[33] Am 3. März 2011 berichtete das ARD-Magazin Panorama über Quecksilberverseuchungen des Bodens an der Erdgasbohrstätte Söhlingen
in Niedersachsen. Die Behörden und der Konzern ExxonMobil, der hier auch die Fracking-Technik anwandte, bestritten, dass die Verunreinigungen beim
Bohren selbst zustande kamen. Es habe sich um eine Transport-, nicht um eine Bohrleitung gehandelt.[34]
Die Kritik in Deutschland stützt sich neben wissenschaftlichen und journalistischen Berichten aus den USA auch auf eine Studie von Werner Zittel[35]
sowie auf Aussagen von Bernhard Cramer von der Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe.[30]
Die Unternehmen BNK Petroleum und Realm Energy planen nach eigenen Angaben (Stand November 2010) Testbohrungen in Deutschland, inklusive
des Einsatzes von Chemikalien. Exxon plant nach eigenen Angaben zwei weitere Fracking-Bohrungen bis Ende 2011. Zahlreiche Politiker und Bürger fordern,
diese zu unterlassen bzw., falls die Unternehmen auf ihren Plänen beharren sollten, zu verbieten.[36] In Nordrhein-Westfalen und Niedersachsen befassen
sich mehrereBürgerinitiativen kritisch mit der Technik.[37] Neben dem Bundesstaat New York haben auch Frankreich und Südafrika Moratorien verhängt bzw.
die Technik gesetzlich verboten. Berichte, dass man sich in Nordrhein-Westfalen mit ExxonMobil auf ein Moratorium geeinigt habe, dementierte der Konzern.
[38][39] Die Fracking-Technik hat inzwischen mehrmals den nordrhein-westfälischen Landtag beschäftigt. Wissenschaftliche Untersuchungen sollen nun
klären, ob von ihr eine Gefahr für Mensch und Umwelt ausgeht. Zudem laufen politische Initiativen zur Änderung des Bergrechts, das das
Genehmigungsverfahren bisher nur auf der Ebene der Bergämter regelt.[40]
Die Arbeitsgemeinschaft Wasserwerke Bodensee-Rhein (AWBR), der 72 Wasserversorgungen aus fünf Bundesländern angehören, spricht sich gegen
diese Form der Erdgasförderung aus, da im Untergrund Stoffe eingesetzt werden, die alswassergefährdend eingestuft und aus öko- und
humantoxikologischer Sicht als kritisch anzusehen sind.[41]
Entzündliches Erdgas im Trinkwasser
In den letzten Jahren ist speziell in den USA das Thema der möglichen Verunreinigung von Grundwasser durch Methan infolge von Hydraulic Fracturing
kontrovers diskutiert worden. Der im Jahr 2010 von Josh Fox gedrehte und vielfach ausgezeichnete Dokumentarfilm Gasland widmet sich ausführlich
der Thematik.[42] Gezeigt wird unter anderem, dass die Konzentration des Gases in Wasserleitungen so hoch sein kann, dass sich das Wasser aus
dem Wasserhahn mit einem Feuerzeug entzünden lässt.[43] Genauer betrachtet lässt sich dabei nicht das Wasser bzw. Gas-in-Wasser-Gemisch
selbst entzünden, sondern das Gas, das nach dem Austritt des Wassers aus dem Wasserhahn freigesetzt wird und sich als Gas-Raumluft-Gemisch
entzündet. Die Zündquelle muss wie beim Gasleck einer Rohrleitung nicht unbedingt ein Feuerzeug sein: Ein Funken (z. B. aus einem Elektromotor)
oder eine brennende Zigarette genügen schon für eine Explosion.
Während Josh Fox in seinem Film Gasland Hydraulic Fracturing als Ursache für das gelöste Methan im Trinkwasser anführt, wird dies von den beteiligten
Firmen bestritten. Aus Anlass der Premiere von Gasland veröffentlichte das Umweltministerium von Colorado deshalb eine vierseitige Erklärung, in der die
Ermittlungen in den aus Colorado geschilderten Fällen zusammengefasst werden. Demzufolge wurde im Rahmen der Untersuchungen festgestellt,
dass Hydraulic Fracturing nur bei einem der drei Fälle die Ursache für die Verunreinigung ist, da es sich bei den anderen beiden Fällen um Gas aus Kohleflözen
handelt die nicht vom Fracking betroffen wären.[44] Als Reaktion hierauf holte Fox Rat vom Strukturgeologen Dr. Anthony Ingraffea ein, der ihm bestätigte,
dass es auch in diesen Kohleflözen durch das Fracking zu Rissen kommen kann und somit Gas freigesetzt wird.[45]
2011 untersuchten Wissenschaftler der Duke University in North Carolina das Trinkwasser von 60 Hausbrunnen in der Umgebung von Schiefergasbohrungen.[46]
13 von 26 Trinkwasserbrunnen in einem Umkreis von einem Kilometer der Bohrungen waren so stark mit Methan angereichert, dass sie über den geltenden
staatlichen Grenzwerten lagen. Von 34 Brunnen, die weiter entfernt lagen, überschritt nur einer diese Grenzwerte.
Laut den Wissenschaftlern gibt es für die erhöhten Werte drei mögliche Quellen, sollte Fracturing die Ursache sein:
· ein Gasaustritt durch undichte Bohrungsverrohrung und Bohrungszementierung,
· der Transport durch Tiefenwasserströme oder
· die Wanderung von Erdgas aus der Lagerstätte durch während des Fracturings erzeugte Risse.
Die Studienautoren schließen einen Zusammenhang mit Fracturing also nicht aus; sollte dies der Fall sein, so nehme man an, dass die wahrscheinlichste
Ursache hierfür undichte Verrohrung und Zementierung während der Bohrungen sein könnte. Die Verrohrung und Zementierung von Bohrungen ist dabei
unabhängig davon, ob im Zuge der Gasbohrung Hydraulic Fracturing eingesetzt wurde oder nicht und außerdem stark von den im jeweiligen Staat
geltenden Umweltgesetzen abhängig, so dass solche Effekte prinzipiell auch bei konventionellen Öl-oder Gasbohrungen möglich sind.
Während die genannte Studie wie oben beschrieben Methan im Trinkwasser feststellen konnte, wurden bei keiner der Proben Spuren der beim
Hydraulic Fracturing verwendeten Chemikalien gefunden. Dies könnte darauf hinweisen, dass das Methangas nicht aus Fracturing-Quellen stammt.
Möglich ist aber auch, dass die Gefahrstoffe bei der Wasseraufbereitung oder beim Durchfließen von „filternden“ Gesteinsschichten abgetrennt wurden.
Sollten nicht größere Mengen als Probe für die Untersuchungen eingedampft worden sein, käme schließlich auch die Möglichkeit in Betracht, dass die
Nachweisgrenzen allein durch die starke Verdünnung im Grundwasser nicht erreicht wurden.
Die Brandgefahr, die von dem im Leitungswasser vorliegenden Methan ausgeht, ist unterschiedlich. Der Grund hierfür ist, dass die Löslichkeit von
Gasen in Flüssigkeiten inner- und außerhalb von Trinkwasserleitungen vom jeweils umgebenden Druck abhängig ist. Insbesondere Alkane sind in
Wasser kaum löslich, hierzu gehört auch das hauptsächlich im Erdgas vorkommende Methan.[47] Dieses Gas liegt während des Transportvorgangs
daher nur zum Teil (durch den Druck in den Leitungen) gelöst vor, ein anderer Teil wird als ungelöste Gasblasen (also eine Art Schaum) vom Wasser
mitgetragen. Gasblasen in Rohrleitungen werden, sofern sie keinen Kontakt mit Sauerstoff haben und mangels Zündquellen (sie benötigen zur Explosion
Aktivierungsenergie) als nicht explosiv angesehen. Nach bzw. während des Abzapfens von Trinkwasser und dem anschließenden Stehenlassen
desselben unter atmosphärischem Druck gasen sie – ebenso beim Kochen in Wasser – jedoch aus, was in Anwesenheit von entsprechenden
Zündquellen, z. B. Gasherde o. ä., zumindest eine kleinere Stichflamme erzeugen kann.
Die möglichen gesundheitlichen Folgen durch Konsum von mit Erdgas kontaminiertem Trinkwasser sind bislang kaum untersucht. In Erdgasen
liegen jedoch häufig Verbindungen wie Schwefelwasserstoff und Quecksilberdämpfe vor; aufgrund des geringen Geruchsschwellenwertes des
Schwefelwasserstoffs würde damit kontaminiertes Trinkwasser vom Konsumenten (und von der die Trinkwasserqualität überwachenden Behörde)
kaum als Trinkwasser akzeptiert werden.
Natürliche Gasvorkommen in oberflächennahen Grundwasserschichten sind jedoch ebenfalls seit langem bekannt. Sie bildeten häufig den Grundstein
für die erste Nutzung von Erdgas, lange bevor Tiefbohrungen technisch möglich waren. Ein Beispiel dafür sind die oberflächennahen Gasfunde in den
Brunnen der Stadt Wels in Österreich, wo insgesamt vom Ende des 19. Jahrhunderts bis 1946 rund 150 flache, teils von Hand gebohrte Gasbrunnen
erstellt wurden, nachdem man zunächst lediglich das Grundwasser für Trinkwasserversorgung erschließen wollte, dann aber das darin gelöste Methan
zur eigenen Energieversorgung und für Heizzwecke nutzte. Auch heute existiert dort noch ein betriebsfähiger Gasbrunnen im Garten der "Kaiserkrone"
nahe am Bahnhof.[48]
Erdbeben
Das Auslösen von Mikrobeben ist das Prinzip des Hydraulic Fracturing. Es wird eine Überspannung aufgebaut, die das Gestein lokal aufreißt.
Dadurch können theoretisch bereits bestehende Erdspannungen gelöst werden, so dass es zu schwachen lokalen Erdbeben kommen kann.
Die Gefahr zerstörerischer Erdbeben ist jedoch nicht gegeben, da das Fracken selbst dazu viel zu kleinräumig und zu energiearm ist.
Nachdem im Frühling 2012 in der Gegend von Blackpool zwei kleine Erschütterungen der Stärke 2,3 und 1,5 registriert wurden, hat die Londoner Regierung
weitere Fracking-Maßnahmen nur mit der Auflage genehmigt, dass die Betreiber seismische Aktivitäten sehr genau beobachten.[49] Die nachfolgende
Untersuchung zeigte, dass diese Erschütterungen auf die beginnenden Fracking-Aktivitäten in der Gegend zurückzuführen sind. Die Ereignisse von
Blackpool blieben bisher ein Einzelfall. Bei vielen tausend durchgeführten Frackoperationen ist bisher Ähnliches nicht beobachtet worden. Experten
schließen Schadensbeben infolge von Frackingarbeiten vollständig aus.[50] Ein Erdbeben ist erst ab Stärke 3 auf der Richterskala vom Menschen
sicher wahrnehmbar, verursacht jedoch noch keinerlei Schäden. Während der Umweltausschuss im niedersächsischen Landtag gerade über
mögliche Gefahren des Frackings beriet und Sachverständige anhörte, bebte am 13. Februar 2012 in der Nähe eines Erdgasfeldes bei
Neuenkirchen-Tewel die Erde mit einer Stärke von 3,0. Experten des Landesamtes für Bergbau, Energie und Geologie hielten Fracking nicht für
den Verursacher des Erdbebens, da nach Angaben der Erdgasindustrie das letzte Frack-Verfahren dort zwei Jahre zuvor stattgefunden hatte.
Da 2004 im gleichen Gasfeld schon einmal ein Beben stattfand, könnte konventionelle Erdgasförderung das Erdbeben ausgelöst haben.[51]
In Ohio dagegen konnten Erdbeben auf das Fracking zurückgeführt werden.[52]
Deutsche Politiker fordern mittlerweile die Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprüfung vor dem Fracken. Zudem will man Trinkwassergebiete
künftig aus der Erdgasförderung herausnehmen.[51]
Clean-Fracking in Österreich
Die Montanuniversität Leoben entwickelte gemeinsam mit dem Öl- und Gaskonzern OMV im österreichischen Weinviertel ein Pilotprojekt, bei dem
das sogenannte Clean-Fracking angewandt werden sollte. Beim Clean-Fracking will man auf Chemikalien verzichten und nur Wasser, Bauxit-Sand
und Stärke einsetzen. Durch Probebohrungen sollten Bohrkerne gewonnen werden, um anhand der geomechanischen Eigenschaften der Kerne
die Machbarkeit des Clean-Frackings zu bestätigen. Es wurde vermutet, dass die Methode zwar umweltverträglicher, aber wirtschaftlich weniger
effizient ist.[53] 2012 wurde das Projekt wegen Unwirtschaftlichkeit eingestellt.[54]
Die Probebohrungen im Weinviertel waren in den Regionen um die Stadt Poysdorf und das Dorf Herrnbaumgarten geplant. Aufgrund von Bürgerprotesten
haben die politischen Entscheidungsträger über die Medien der OMV die Probebohrungen auf deren Grund verwehrt.[55] Es folgte eine Verankerung
einer verpflichtenden Umweltverträglichkeitsprüfung für Schiefergasbohrungen. In Österreich bildete sich eine Bürgerinitiative, um auf die Gefahren
des Schiefergas-Frackings hinzuweisen.[56]
Fracking in Deutschland
Geschichte des Hydraulic Fracturing in Deutschland
Hydraulic Fracturing ist in Deutschland sowohl zum Zwecke der Verbesserung der Produktivität von Kohlenwasserstoffbohrungen
als auch bei Geothermiebohrungen in Verwendung. Das erste Hydraulic Fracturing in Deutschland fand 1961 statt. Seit damals
sind bundesweit ungefähr 300 Fracs durchgeführt worden[57], die meisten davon in Niedersachsen. Die bisher einzige Anwendung
in Nordrhein-Westfalen fand 1995 in der Kohleflözgasbohrung Natorp 1 bei Warendorf statt[58]. Hydraulic Fracturing wird nicht nur zur
Erdgasförderung eingesetzt, sondern auch zur Trinkwassergewinnung und zur Altlastensanierung. In der Geothermie wird ein technisch
ähnliches Verfahren zur Verbesserung der Lagerstätteneigenschaften (Stimulation) angewendet, bei dem allerdings im Gegensatz zum
Hydraulic Fracturing als Arbeitsmittel nur Wasser ohne chemische Zusätze verwendet wird.[8]
Zu Beginn wurde diese Technik ausschließlich in vertikalen Bohrungen angewendet. Die Bohrung Söhlingen Z10, die 1994 errichtet wurde,
war die erste Bohrung in Deutschland, bei der mehrere Fracs in einer horizontalen Bohrung vorgenommen wurden.[59] Diese Kombination
von Horizontalbohrungen und Hydraulic Fracturing ermöglichte es, die Produktion pro Bohrung drastisch zu erhöhen, und wurde deshalb in den letzten Jahren häufiger verwendet. Seit 2008 führt ExxonMobil in einigen Gebieten Niedersachsens und Nordrhein-Westfalens Aufsuchungsprojekte durch. Im Oktober 2009 kündigte der seinerzeitige Ministerpräsident von Niedersachsen, Christian Wulff,
an, dass der Konzern ExxonMobil in Niedersachsen nach unkonventionellem Erdgas suchen werde. Die Presse berichtete über Millioneninvestitionen,
die in diesem Zusammenhang geplant seien.[60] ExxonMobil hat inzwischen die Arbeiten in Deutschland eingestellt und wartet auf weitere
Untersuchungsberichte.
Debatte über Fracturing in Deutschland
Im Jahr 2010 lösten Initiativen von Politikern und Bürgern sowie Berichte in verschiedenen Medien eine Debatte über Hydraulic Fracturing
in Deutschland aus. In Deutschland gibt es laut Schätzungen der Bundesanstalt für Geowissenschaften zwischen 7 bis 22 Billionen Kubikmeter
Schiefergas, von denen sich etwa 10% mittels Fracking fördern ließen.[61]
Da sich in der öffentlichen Diskussion viele Bedenken und Fragen von besorgten Bürgerinnen und Bürgern zeigen, versucht ExxonMobil diese
Fragen im Rahmen eines Informations- und Dialog-Prozesses zu sammeln und durch einen Expertenkreis[62] von unabhängigen Wissenschaftlern
klären zu lassen. Die Fragen können auf einer Online-Plattform[63] eingereicht werden. Die Ergebnisse der Experten werden ebenfalls öffentlich
gemacht. Die Sprecherin von ExxonMobil bezeichnete „Hydraulic Fracturing“ gegenüber Zeit Online als „wassersparende“ Methode. Zu den in
Deutschland geplanten Probebohrungen zitierte der Bericht die Antwort der Bundesregierung auf eine Kleine Anfrageder Grünen, wonach man
glaube, „dass bei Förderung, Transport und Verbrennung keine Unterschiede zum konventionellen Erdgas auftreten.“[64] Der Bundestagsabgeordnete
Oliver Krischer (Bündnis 90/Die Grünen) kritisierte in einem Interview den geringen Kenntnisstand der Bundesregierung über die in
Deutschland vorgenommenen oder geplanten Probebohrungen.[65]
Das Deutsche Geoforschungszentrum (GFZ) gab an, die Folgen der Technik für die Umwelt bisher nicht untersucht zu haben.[66]
„In Deutschland gibt es einen Run auf neue Erdgasquellen: Energieunternehmen wie Exxon, BNK Petroleum oder die Stadtwerke Hamm hoffen
auf satte Erlöse. Allerdings setzen sie dabei auf unkonventionelle Fördermethoden - und die bergen große Risiken. Im Oktober 2008 bohrte ExxonMobil,
in Deutschland vor allem durch seine Tankstellenmarke Esso bekannt, in der Nähe der Ortschaft Damme. Drei Mal presste der Konzern
Fracking-Flüssigkeit in das Bohrloch, 1100 bis 1500 Meter tief in die Erde. Insgesamt leitete der Konzern ungefähr zwölf Millionen Liter Flüssigkeit
in den Untergrund. Diese bestand zu 98 % aus Wasser, wie ExxonMobil mitteilt. Hinzu kamen Quarzsand und sechs Chemikalien, die einen Anteil
von 0,2 Prozent an der Flüssigkeit hatten. Insgesamt presste ExxonMobil also rund 24.000 Liter Chemikalien in den Boden, wie viel von welchem
Stoff, teilte der Konzern nicht mit.[30]“
Das Umweltbundesamt veröffentlichte 2012 ein Gutachten zu den Umweltauswirkungen des Frackings. Das Gutachten betont eine unsichere
Datenlage und verweist genehmigungsrechtlich auf das Chemikaliengesetz und das Wasserrecht. Weiterhin wird eine standortspezifische
Risikoanalyse vor Bohrbeginn und ein Verbot von Bohrungen in Trinkwasserschutzgebieten empfohlen.[67] In einer Stellungnahme der
Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe (BGR) zu diesem Gutachten wird dieses kritisiert. Beispielsweise seien „bisher durchgeführte
Frackoperationen…im Gutachten keiner substantiellen Analyse unterzogen“ und die „…mechanischen Prozesse beim Frackvorgang…nicht korrekt
dargestellt“ worden. Das Gutachten wird als „subjektiv“, auf veralteten Theorien beruhend, stellenweise beleglos, grundlegende Informationen,
die Stand von Wissenschaft und Technik sind, nicht berücksichtigend bezeichnet.[68]
Diese Stellungnahme der BGR stammt vom Oktober 2010, wurde aber erst am 18. Januar 2013 veröffentlicht.[69] Die Stellungnahme wurde nach
Angaben des Handelsblattes wegen ihrer politischen Brisanz bisher von der Bundesregierung zurückgehalten.[70] Die Stellungnahme der BGR
hält den umweltverträglichen Einsatz von Fracking zur Gewinnung von unkonventionellen Erdgasvorkommen für „grundsätzlich möglich“,
„sofern die gesetzlichen Regelungen eingehalten, die erforderlichen technischen Maßnahmen getroffen und standortbezogene Voruntersuchungen
durchgeführt werden“. Dies decke sich mit der Hauptaussage des UBA-Gutachtens, „dass eine Erkundung und Förderung von Schiefergas
unter bestimmten Voraussetzungen mit dem Trinkwasserschutz vereinbar ist“.[68]
Literatur
· Charles G. Groat und Thomas W. Grimshaw: Fact-Based Regulation for Environmental Protection in Shale Gas Development (PDF; 3,12 MB). Energy Institute, University of Texas at Austin. Februar 2012.
· Anna Alexandra Seuser: Unkonventionelles Erdgas: Begehrte Ressource mit Unwägbarkeiten. In: Natur und Recht 34 (2012), Seite 8–18.
· Christian Tenbrock und Fritz Vorholz: Amerika im Gasrausch. Fracking könnte die Welt verändert – doch Zweifel wachsen, wie groß die Vorräte wirklich sind. In: Die Zeit, Ausgabe vom 7. Februar 2013, Seite 21.
Weblinks
Dokumente
· Einschätzung der Schiefergasförderung in Deutschland Umweltbundesamt, August 2011
· ORF News: Ölfirmen sichern sich Vorkommen, abgerufen am 10. Juni 2012
· Versorgungssicherheit durch Erdgas aus unkonventionellen Lagerstätten Interview mit Bernhard Cramer, BGR und Kurt M. Reinicke, TU Clausthal, WEG kompakt 5/2010 (Wirtschaftsverband Erdöl- und Erdgasgewinnung)
· Artikel Methan-Verunreinigungen - Gasbohrungen machen Trinkwasser explosiv, Spiegel Online am 10. Mai 2011
· Artikel Fragwürdige Fördertechnik: Benebelt vom Gas-Rausch, Spiegel Online am 19. August 2010
· Wenn Trinkwasser brennt, Deutsche Welle am 16. August 2010
· Gift aus dem Wasserhahn, ZEIT online am 13. August 2010
· Buried Secrets. Artikelserie Pro Publica, 113 Teile, Abraham Lustgarten u.a. (englisch)
· Gasland Offizielle Website des Films (englisch)
Videos und Reportagen
· Fracking: Risiko für unsere Umwelt?, Video (3 Min.) - 3 Fragen - 3 Antworten mit BM Altmaier / YouTube-Channel der Bundesregierung
· Kritik an den Recherchemethoden zum Film Gasland, abgerufen am 17. Februar 2012 auf „Whats up with that“.
· Reportage von 3sat über den Film 'Gasland', synchronisierte Ausschnitte aus dem Film, abgerufen am 7. Februar 2012 auf youtube.com
· 'Gasrausch – Wie hoch ist der Preis für die Ausbeute von Schiefergas?' weitere Reportage bei 3sat.de, abgerufen am 7.Februar 2012 und Begleittext dazu, Hitec
· Exxon: US-Konzern vergiftet Grundwasser in Norddeutschland, Panorama, abgerufen am 7. Februar 2012
· Gefahr fürs Trinkwasser? Wie internationale Konzerne in Deutschland Erdgas fördern, Monitor, abgerufen am 7. Februar 2012 auf youtube.com
· „Hilfe, mein Wasser brennt!“, SPIEGEL-Online Video, abgerufen am 7. Februar 2012
· 'Gefährliche Gier - die riskante Suche nach Erdgas in Deutschland', 30-minütige Reportage von ZDFzoom, abgerufen am 4. Oktober 2012 auf youtube.com
· Animation der Fa. Chevron über die Fracking-Technik, abgerufen bei Chevron.com am 28. Oktober 2012
Spielfilme
· Promised Land (2012), Regie: Gus van Sant, mit Matt Damon, Frances McDormand, u.a.
Einzelnachweise
1. ↑ Hydraulic Fracturing Facts. Chesapeake Energy, abgerufen am 6. Oktober 2012 (html, englisch).
2. ↑ Chemicals that may be used in Australian CSG fraccing fluid. Australian Petroleum Production & Exploration Association Ltd, abgerufen am 6. Oktober 2012 (pdf, 100kB, englisch).
3. ↑ stocks.investopedia.com/stock-analysis/2010/Will-The-EPA-Crack-Down-On-Fracking Will The EPA Crack Down On „Fracking“? Investopedia, 10. Juli 2010, abgerufen am 6. Oktober 2012 (html, englisch).]
4. ↑ glossary.oilfield.slb.com Schlumberger Oilfield Glossary
5. ↑ Erdgasmarkt: Umweltvorschriften könnten die Aussichten trüben. Frankfurter Allgemeine Zeitung, abgerufen am 16. Dezember 2012 (html, deutsch).
6. ↑ Hydraulisches Aufbrechen. European Onshore Energy Association, abgerufen am 16. Dezember 2012 (html, deutsch).
7. ↑ NiKo: Erdöl und Erdgas aus Tonsteinen – Potenziale für Deutschland. Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe, abgerufen am 16. Dezember 2012 (html, deutsch).
8. ↑ a b c Guido Blöcher et al: Hintergrundpapier zur Stimulation geothermischer Reservoire. GtV-Bundesverband Geothermie, 9. Mai 2012, abgerufen am 6. Oktober 2012 (PDF, 1MB).
9. ↑ Montgomery, Carl T., Smith, Michael B.: Hydraulic Fracturing: History of an Enduring Technology. In: Society of Petroleum Engineers (Hrsg.): Journal of Petroleum Technology. 62, Nr. 12, Dezember 2010, S. 26–32. Abgerufen am 5. Januar 2011.
10. ↑ Howard, G.C. and C.R. Fast (editors), Hydraulic Fracturing, Monograph Vol. 2 of the Henry L. Doherty Series, Society of Petroleum Engineers New York, 1970.
11. ↑ Watson, T.L., Granites of the southeastern Atlantic states, U.S. Geological Survey Bulletin 426, 1910.
12. ↑ David Banks, Odling, N.E., Skarphagen, H., and Rohr-Torp, E.: Permeability and stress in crystalline rocks. In: Terra Nova. 8, Nr. 3, 1996, S. 223–235. doi:10.1111/j.1365-3121.1996.tb00751.x.
13. ↑ Fiona Harvey: „Gas 'fracking' gets the green light“, The Guardian, 17. April 2012
14. ↑ a b Evaluation of Impacts to Underground Sources of Drinking Water by Hydraulic Fracturing of Coalbed Methane Reservoirs Study (2004)
15. ↑ Vgl. „Drill Baby Drill! The Fracking Bubble is Bursting!“, DailyKos.com, 15. Aug. 2012
16. ↑ Polens riskanter Traum vom Gas-Reichtum Artikel auf Zeit Online: Experten rechnen mit 5,3 Billionen Kubikmetern Schiefergas – 500mal mehr, als Polen pro Jahr verbraucht. Die polnische Regierung wolle auf diesem Weg von russischen Erdgasimporten loskommen wie auch von der heimischen Kohle und langfristig selbst zum Energie-Exporteur werden.
17. ↑ http://www.n-tv.de/politik/Bund-will-Fracking-erlauben-article10092801.html
18. ↑ Kathrin Gotthold, Holger Zschäpitz: USA steigen zum weltgrößten Gasproduzenten auf. In: Die Welt. 12. Juli 2012, abgerufen am 20. Januar 2013.
19. ↑ Brian Westenhaus: New Fracking Technology to Bring Huge Supplies of Oil and Gas to the Market. In: OilPrice.com. 16. Januar 2012, abgerufen am 20. Januar 2013.
20. ↑ A. Trembath: US Government Role in Shale Gas Fracking History: An Overview and Response to Our Critics. The Breakthrough Institute, vom 2. März 2012
21. ↑ A. Sickle: PA Politician Calls for Moratorium on Gas Drilling Permits In: www.dcburo.org vom 21. April 2010
22. ↑ Große Hoffnung Shale Gas: „Ein totaler Humbug“; Interview mit dem EWG-Energieexperten Dr. Werner Zittel, n-tv.de, 20.?Mai 2010 [1]
23. ↑ Indirect Emissions of Carbon Dioxide from Marcellus Shale Gas Development (PDF-Datei; 1,46 MB) Robert Howarth et al, Cornell University
24. ↑ Professors Fight Over Fracking Impact
25. ↑ Life Cycle Greenhouse Gas Emissions of Marcellus Shale Gas, Mohan Jian et al.
26. ↑ Einschätzung der Schiefergasförderung in Deutschland
27. ↑ US Department of Energy: Modern shale gas development in the United States. (PDF-Datei; 5,11 MB) April 2009, S. 61-64.
28. ↑ Der Spiegel, 42/2011, Seite 90
29. ↑ US-Konzern presste giftige Chemikalien in Niedersachsens Boden Artikel auf Spiegel Online
30. ↑ a b c d Fracking: Erste Probe-Bohrungen Anfang 2014 Artikel in der Braunschweiger Zeitung
31. ↑ Chemicals Were Injected Into Wells, Report Says, New York Times, 16. April 2011
32. ↑ EPA's Draft Hydraulic Fracturing Study Plan
33. ↑ Frauke Steffens, Ralph Hötte, Markus Schmidt: Gefahr fürs Trinkwasser? Wie internationale Konzerne in Deutschland Erdgas fördern. 18. November 2010, abgerufen am 3. Januar 2013 (Video auf Youtube).
34. ↑ Johannes Edelhoff, Alexa Höber, Birgit Wärnke: Exxon: US-Konzern vergiftet Grundwasser (PDF-Datei; 116 kB) Panorama vom 3. März 2011
35. ↑ Kurzstudie „Unkonventionelles Erdgas“ (pdf, 32 Seiten; 872 kB)
36. ↑ Thorsten Pfänder: Seite nicht mehr abrufbar, Suche im Webarchiv: [4] WDR, Lokalzeit aus Dortmund, 2. Februar 2011
37. ↑ Interessengemeinschaft „Gegen Gasbohren“
38. ↑ Jürgen Polzin: Wasserversorger fordern Stopp der Erdgasbohrungen in NRW WAZ
39. ↑ Jörn Krüger: Exxon will vom Moratorium nichts wissen
40. ↑ Kritik im Landtag, rp online
41. ↑ Mitglieder-Information Newsletter 09 (2011) (PDF-Datei; 1,98 MB) Arbeitsgemeinschaft Wasserwerke Bodensee-Rhein
42. ↑ Feuer aus dem Wasserhahn Artikel auf Spiegel Online
43. ↑ Vgl. „Hilfe, mein Wasser brennt!“, SPIEGEL-Online Video, 15. November 2010
44. ↑ Stellungnahme des Colorado Department of Natural Resources zu Gasland (PDF; 46 kB)
45. ↑ http://1trickpony.cachefly.net/gas/pdf/Affirming_Gasland_Sept_2010.pdf
46. ↑ Methane contamination of drinking water accompanying gas-well drilling and hydraulic fracturing, Osborn et al. 2011 (PDF; 1008 kB)
47. ↑ Chemielexikon
48. ↑ Erdöl und Erdgas in Österreich, http://www.wabweb.net/history/oel/ooe.htm
49. ↑ Fiona Harvey und Adam Vaughan: Fracking for shale gas gets green light in UK. In: The Guardian vom 13. Dezember 2012
50. ↑ M. Joswig: Fracking und Seismische Ereignisse - Erdbeben und Fracking. 4. Arbeitstreffen des Akteurskreises vom 9. Dezember 2011
51. ↑ a b Deutschlandfunk vom 16. Februar 2012: Erdgasförderung als Erdbeben-Auslöser? In Niedersachsen wird über das „Fracking“ diskutiert
52. ↑ Ohio Earthquakes: Officials Say Tremors Were 'Almost Certainly' Caused By Wastewater Injection. In: The Huffington Post vom 9. März 2012
53. ↑ Nur Wasser, Stärke, Sand und sonst nix
54. ↑ www.omv.at/schiefergas]
55. ↑ Bürgermeister sagen NEIN
56. ↑ Homepage der Initiative „Weinviertel statt Gasviertel“
57. ↑ „Towards Future Technological Developments/Potential of Shale Gas“, Kurt M. Reinicke, TU Clausthal (PDF-Datei; 5,06 MB)
58. ↑ „Fracking“ 1995 ohne Erfolg, Müsterlandzeitung vom 21. März 2011, Christoph Klem
59. ↑ „Soehlingen Z10: Drilling Aspects of a Deep Horizontal Well for Tight Gas“, G. Pust, J. Schamp, 1995
60. ↑ Exxon sucht in Niedersachsen nach Erdgas, HAZ vom 4. Oktober 2009, Klaus Wallbaum
61. ↑ Piotr Heller: Mit Hochdruck. Erdgasförderung durch Fracking als Reizthema. Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung, 24. Februar 2013, Ausgabe Nr. 8, S. 61.
63. ↑ Informations- und Dialogprozess über die Sicherheit und Umweltverträglichkeit der Fracking Technik
64. ↑ Gift aus dem Wasserhahn, Zeit Online 13. August 2010, Frauke Steffens
65. ↑ Wenn Trinkwasser brennt, Deutsche Welle Radio 16. August 2010, Frauke Steffens
66. ↑ Benebelt vom Gasrausch, SPIEGEL online 19. August 2010, Stefan Schultz
67. ↑ Umweltauswirkungen von Fracking bei der Aufsuchung und Gewinnung von Erdgas aus unkonventionellen Lagerstätten. Umweltbundesamt, 6. September 2012, abgerufen am 12. Februar 2013 (PDF, Mediendatenbank, Übersicht Lang- und Kurzfassung, englische Version). Presse-Information
68. ↑ a b Stellungnahme der Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe zum Gutachten des Umweltbundesamtes (UBA) „Umweltauswirkungen von Fracking bei der Aufsuchung und Gewinnung von Erdgas aus unkonventionellen Lagerstätten – Risikobewertung, Handlungsempfehlungen und Evaluierung bestehender rechtlicher Regelungen und Verwaltungsstrukturen". Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe, 1. Oktober 2012, abgerufen am26. Februar 2012 (Pdf, 544 kB).
69. ↑ Stellungnahme der Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe zum Gutachten des Umweltbundesamtes (UBA) „Umweltauswirkungen von Fracking bei der Aufsuchung und Gewinnung von Erdgas aus unkonventionellen Lagerstätten – Risikobewertung, Handlungsempfehlungen und Evaluierung bestehender rechtlicher Regelungen und Verwaltungsstrukturen". BGR, 18. Januar 2013, abgerufen am 26. Februar 2012 (Html).
70. ↑ Behörden streiten über neue Gasfördertechnik In: Handelsblatt Online, 03.01.2013. Abgerufen am 16. Januar 2013
http://de.wikipedia.org/wiki/Hydraulic_Fracturing